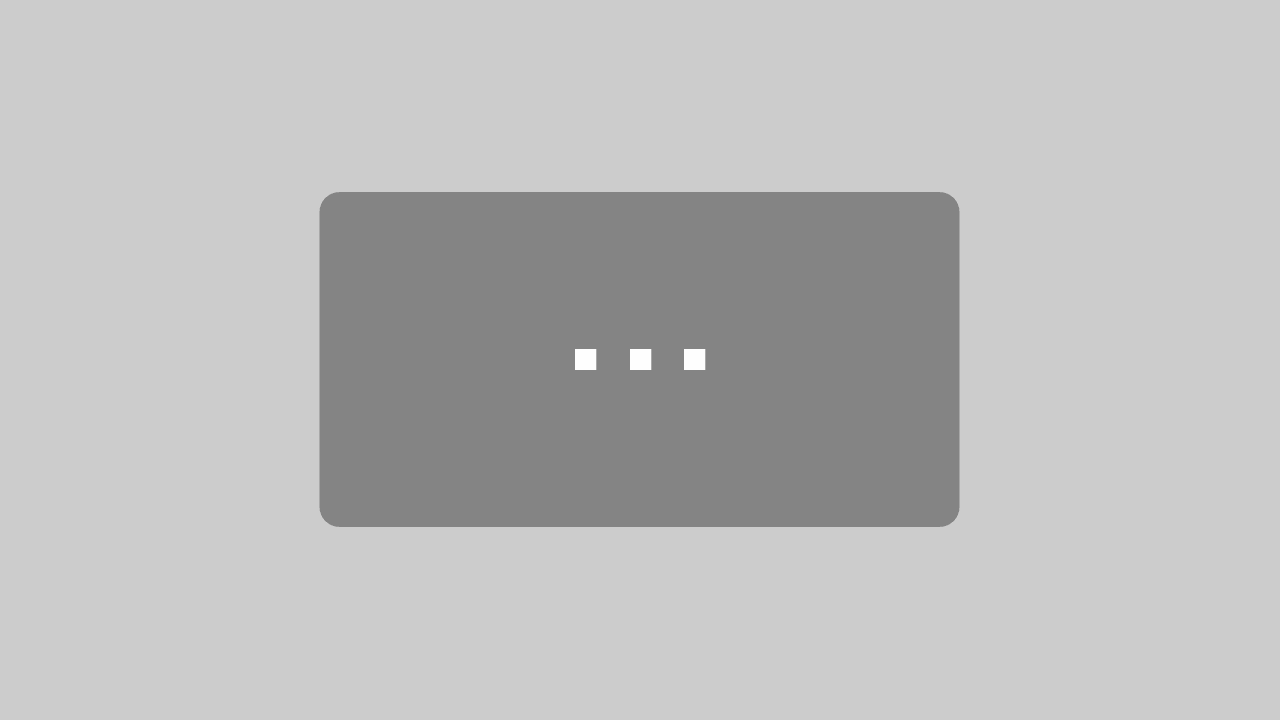News
Unterwegs an Europas Grenzen: Griechenland

Kaum ein anderes Land ist schon so lange im Zentrum der Debatten über Flüchtlingspolitik wie Griechenland. Grund genug für einen Besuch bei unseren Kolleg*innen von Refugee Support Aegean (RSA), die das Leiden und Sterben von Schutzsuchenden noch unmittelbarer erleben als wir und seit Jahren dagegen kämpfen. Eindrücke aus sechs Tagen vor Ort.
Da Geflüchtete es durch zunehmende Abschottung oft gar nicht mehr in die Europäische Union schaffen, wird es immer wichtiger, die Zustände an den Grenzen zu dokumentieren und gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Schon seit 2007 ist PRO ASYL deshalb immer wieder in Griechenland aktiv. 2017 wurde aus unserer langjährigen Kooperation mit dortigen Anwält*innen, Dolmetscher*innen und Sozialarbeiter*innen eine eigene Organisation: Refugee Support Aegean. 18 Kolleg*innen sind dort mittlerweile beschäftigt, sie arbeiten auf Lesbos, Chios und dem griechischen Festland. Mitte Juli haben wir sie auf ihrem Jahrestreffen in Athen und anschließend auf Lesbos besucht.
Tag 1: Athen – Reswanas Geschichte
In den folgenden drei Tagen werden auf dem Jahrestreffen von RSA die aktuellen Herausforderungen besprochen. Und davon gibt es viele: Das Schiffsunglück rund vier Wochen zuvor vor der Küste von Pylos mit hunderten Toten beschäftigt die Anwält*innen quasi rund um die Uhr. Die geplanten Änderungen im EU-Asylsystem werden auch die Arbeit von RSA verändern. Und illegale Pushbacks gibt es in Griechenland zwar schon lange, aber seit 2019 werden sie immer mehr zum bitteren Alltag. Um all das geht es in den Diskussionen.
Am Nachmittag treffen wir Reswana, die junge Frau arbeitet als »cultural mediator« für RSA. Ihre Geschichte ist nicht nur eng mit der Organisation verknüpft, sie steht auch beispielhaft für so vieles, was in der europäischen Flüchtlingspolitik schiefläuft. Und sie ist schwer zu ertragen. Im Oktober 2015 flieht sie mit 14 Jahren aus Afghanistan über das Mittelmeer, das Boot kentert, unter den vielen Toten sind auch Reswanas Eltern und ihre Geschwister. Sie überlebt als einzige ihrer Familie. Die RSA-Kolleg*innen auf Lesbos erinnern sich noch immer an das unter Schock stehende Mädchen im Camp PIKPA, einem Ort der zivilgesellschaftlichen Solidarität für besonders schutzbedürftige Menschen, der 2020 von der griechischen Regierung geschlossen wurde. Heute würde Reswana wohl stattdessen in eines der anonymen Massenlager kommen.
»Es sind jetzt fast acht Jahre, die ich versuche, zu überleben, versuche, meinen Weg zu finden, meine Träume, meine Ziele. Gebt den Menschen mehr Freiheit!«
Reswana kommt in eine Gastfamilie, nach dem Erhalt von Reisepapieren zieht sie 2018 weiter nach Schweden. Hier leben ihre einzigen Verwandten in Europa und hier, so berichtet sie, lernt sie schwedisch, kann endlich neu beginnen, wieder wie eine normale Jugendliche leben. Aber dann wird sie von den schwedischen Behörden vor die Wahl gestellt: Rückkehr nach Griechenland oder Abschiebung nach Afghanistan. Notgedrungen kehrt sie Anfang 2020 nach Griechenland zurück. Nur, weil sich ihre frühere Gastfamilie kümmert, landet sie nach ihrer Rückkehr nicht mitten im Corona-Lockdown obdachlos auf der Straße.

Mittlerweile macht sie in Griechenland eine Ausbildung zur Maskenbildnerin, mit der Hilfe von RSA konnte sie in einem langwierigen DNA-Verfahren ihre toten Angehörigen finden. Sie liegen auf dem Flüchtlingsfriedhof auf Lesbos. Reswana erzählt uns auch, dass sie nie zur Ruhe kommt und auch nach so vielen Jahren immer noch ständig Probleme mit den Behörden wegen ihrer Dokumente hat. Sie sagt:
»Es geht nur um Grenzen. Als ich in Afghanistan war, sagte mein Vater, dass die Europäer nicht in unterschiedlichen Ländern denken, sie seien alle gleich. Aber als ich hierher kam, konnte ich keine Gleichheit erkennen. Viele Kinder sind in andere Länder umgesiedelt worden, aber für mich war das nicht möglich. Ich wünsche mir, dass Europa seine Gesetze ein wenig ändert, dass sie bei Dublin-Fällen nicht so streng sind. Es sind jetzt fast acht Jahre, die ich versuche, zu überleben, versuche, meinen Weg zu finden, meine Träume, meine Ziele. Gebt den Menschen mehr Freiheit! Wenn ich mein Leben mit 14 in Schweden begonnen hätte, wäre ich heute viel stärker, viel weiter in meinem Leben.«
Tag 2: Athen – Pylos und die Arbeit mit den Überlebenden
Heute geht es beim RSA-Treffen unter anderem um das Schiffsunglück vor Pylos. Auch für uns in Deutschland sind solche Geschehnisse immer wieder Ausnahmefälle, aber hier wird für uns deutlich: Die direkte und unmittelbare Arbeit vor Ort ist ganz anders herausfordernd.
Unsere Kolleg*innen haben eine lange und traurige Historie mit Schiffbrüchen, den »shipwrecks«. Verschiedene Daten großer Unglücke mit vielen Toten haben sich hier ins Gedächtnis eingebrannt. Und im Gegensatz zu uns in Deutschland sehen sie jedes Mal die Leichen am Strand oder im Krankenhaus von Lesbos, unterstützen traumatisierte Überlebende nur Tage nach dem Unglück juristisch im Kampf um ihre Rechte, versuchen, verzweifelten Angehörigen bei der Suche und Identifikation ihrer Familienmitglieder zu helfen. »Es ist ja nicht nur ein einzelner Mensch, der ertrunken ist, es ist immer eine ganze Familie betroffen«, wird uns unser Kollege Mohammadi später auf Lesbos erzählen. Er dolmetscht dort seit vielen Jahren und war auf etlichen Begräbnissen von ertrunkenen Geflüchteten. Nach dem ersten Mal, so sagt er, konnte er eine Woche lang nichts essen. Der Geruch verfolgte ihn, die Bilder der bläulich verfärbten Wasserleiche.

»Wir dürfen nicht schweigen, wir müssen die Überlebenden unterstützen, um Gerechtigkeit zu fordern.«
Das Unglück von Pylos aber, das merkt man, erschüttert auch hier alle ganz besonders – denn es ist nicht einfach »nur« ein gekentertes Schiff. Es ist bekannt, dass die griechische Küstenwache und Frontex über die Situation der Menschen auf dem völlig überfüllten Frachter Bescheid wussten, sogar vor Ort waren. Und über viele Stunden keine Maßnahmen für eine Rettung vorbereitet hatten. Unsere Anwält*innen haben mit etlichen Überlebenden gesprochen, sie sind schockiert von den Erzählungen.
»Es ist ein sehr schwerer Fall, es ist ein Verbrechen. Das Wichtigste ist jetzt für uns – und ich denke für die gesamte Gesellschaft in Europa: Wir dürfen nicht schweigen, wir müssen die Überlebenden unterstützen, um Gerechtigkeit zu fordern. Und wir müssen von unseren Regierungen verlangen, dass sie diese Verbrechen an den Grenzen stoppen.« (Marianna Tzeferakou, Anwältin von RSA)
Tag 3: Ritsona, Malakasa, Kara Tepe – Zäune, Mauern, Stacheldraht
Begleitet von einer griechischen Kollegin machen wir uns auf den Weg nach Norden. Wir steuern zunächst das Camp Ritsona an, dorthin ist es ungefähr eine Stunde Fahrt von Athen aus. Rund 3.000 Geflüchtete sind hier untergebracht, ziemlich im Nirgendwo. Neben den Zäunen und Stacheldrähten ist vor einiger Zeit auch noch eine Mauer gebaut worden. Die Geflüchteten sollen hier offenbar nicht sichtbar sein und auch niemanden sehen. »You can’t build a wall around our dreams« hat jemand von außen auf die Mauer geschrieben – und wir fragen uns, wie allein dieser kleine Akt des Widerstands möglich war, denn das gesamte Lager wird von Kameras überwacht.

Die Menschen können das Lager hier zwar verlassen, aber es gibt in der Umgebung nichts. Vor den Toren treffen wir James*, er möchte mit einem Freund nach Athen fahren. Wir nehmen sie ein Stück mit und er erzählt uns von den schlechten Bedingungen im Camp, mangelnder medizinischer Versorgung und dass sie nur 65 Euro im Monat zur Verfügung haben, aber allein die Tickets nach Athen schon 20 Euro hin und zurück kosten. Auffällig ist vor allem seine Angst, von den Securities dabei beobachtet zu werden, dass er in unserem Auto sitzt. Daher möchte er auch keinesfalls mit uns vor der Kamera sprechen, aber er berichtet, dass er schon seit 2020 in Griechenland ist und immer noch auf seine Asyl-Anhörung wartet.
»Die Menschen leben in dem Lager wie in einem Käfig. Keine Medikamente, keine Möglichkeit, richtig zu schlafen. Ich bitte die Regierungen der Europäischen Union, den Einwanderern hier in Griechenland zu helfen. Wir sind in Not, hier gibt es keine Sicherheit für uns.« (James*, Geflüchteter aus einem afrikanischen Land)
Rund 15 Auto-Minuten entfernt von Ritsona liegt Malakasa. Hier stehen gleich zwei große Lager und hier wurden die 104 Überlebenden des Schiffsunglücks vor Pylos untergebracht. Zunächst im »neuen« Lager, einer Containeranlage inmitten einer Steinwüste hinter mehrfachen Stacheldrahtzäunen in der sengenden Sonne. Eine bedrückende Szenerie, modern erscheint hier einzig die Überwachungstechnik.

Nach den ersten Anhörungen wurden die Überlebenden mittlerweile ins »alte« Lager einige Kilometer weiter transferiert. Hier werden wir ziemlich unverzüglich von den allgegenwärtigen Sicherheitskräften gebeten, zu gehen. Fotos oder Videos sind nicht erlaubt. Die Anwält*innen von RSA, die uns wegen des Meetings nicht begleiten konnten, sind hier allerdings mehrfach in der Woche vor Ort und erhalten auch Zugang. Das Lager liegt neben einem militärischen Sperrgebiet, immerhin gibt es in Malakasa aber einen kleinen Ortskern – und einen Zug nach Athen.
Wir hingegen setzen unsere Reise nun in Richtung Süden fort und begeben uns auf die Insel Lesbos, wohl spätestens seit 2015 weltbekannt. Sie liegt nur wenige Kilometer von der Türkei entfernt, trotzdem sterben auf der Flucht übers Meer mit wackligen Schlauchbooten immer wieder Geflüchtete. Nach dem das – ebenfalls zu trauriger Bekanntheit gekommene – Elendslager Moria abgebrannt ist, sind die Schutzsuchenden, die die Überfahrt überleben, im Lager Kara Tepe / Mavrovouni einige Kilometer entfernt untergebracht.

Es steht direkt an der Küste unterhalb von einem kargen Hügel und wurde in kürzester Zeit hochgezogen, dementsprechend muten die Einrichtungen oft provisorisch an. Fotoaufnahmen sind – natürlich – auch hier untersagt, schließlich sollen die Zustände möglichst nicht dokumentiert werden. Wir begeben uns deswegen auf eine Anhöhe, um einen weit entfernten Blick aufs Camp werfen zu können. In der direkten Umgebung des Lagers steht immerhin eine Station, in der Geflüchtete medizinische Hilfe bei NGOs wie »Ärzte ohne Grenzen« erhalten können, denn innerhalb ist die Versorgung katastrophal. Auch die RSA-Anwält*innen auf Lesbos nutzen diese Station, um juristische Unterstützung leisten zu können.
Tag 4: Lesbos – Moria und andere Mahnmale
Wir besuchen unseren Kollegen Mohammadi in seinem »Büro«, dem Vorraum im Krankenhaus von Lesbos. Er dolmetscht dort – und überall wo es sonst noch notwendig ist – für Geflüchtete. Mohammadi kam selbst im Jahr 2002 aus Afghanistan und ist bis heute auf der Insel geblieben. Warum? »Na, ich liebe es hier«, antwortet er knapp aber eindeutig. Zu seiner Arbeit hat er dafür eine ganze Menge zu berichten, wir müssen das ausführliche Gespräch jedoch vertagen und fahren in den Norden der Insel. Dort wird ein neues Lager gebaut, mitten im Wald. In der Nähe befindet sich einzig eine Müllkippe, allein das ist sinnbildlich für die neue Linie der griechischen Behörden. Unsere Kolleg*innen machen sich große Sorgen, dass bei einem Brand aufgrund der Abgelegenheit und der schlechten Straßen kaum eine Evakuierung aus diesem Lager möglich sein wird.

Den letzten großen Brand haben hier alle noch in Erinnerung, und auf dem Weg kommen wir an eben jenem ehemaligen Lager Moria vorbei, das vor über drei Jahren abgebrannt ist. Die Überreste des Kerncamps sind trotzdem noch gut erhalten, man kann sich die beengten Verhältnisse in den Blechhütten nur allzu gut vorstellen, auch wenn wir den Bereich nicht betreten können. Wie überall ist auch dort Polizei zugegen.

»Wir sind sehr erschöpft von der Situation. Es ist eine sich immer wiederholende Situation von Menschenrechtsverletzungen, von Todesfällen. Aber ich glaube an das, was wir tun, ich glaube, dass es hundertprozentig notwendig ist.«
Im Norden von Lesbos angekommen, sehen wir die türkische Küste, sie erscheint so nahe, dass man meint, fast dorthin schwimmen zu können. Aber die See kann hier sehr tückisch sein – und die Küstenwache ist allzeit präsent. Auch auf den Bergen an der Küste sitzen Polizisten neben unscheinbaren Vans und beobachten mit Hightech-Equipment das Meer, auf der Suche nach Flüchtlingsbooten.

Ebenfalls in dieser Gegend befindet sich ein Ort, an dem unzählige Überbleibsel der Menschen liegen, die über das Meer gekommen sind, um in der EU Schutz zu suchen. Schwimmwesten liegen neben Resten von Holzbooten und Rettungsringen. Dazwischen immer wieder auch Kleidungsstücke und einzelne Schuhe. Niemand kann sagen, was aus den Besitzer*innen wurde. Manche Rettungsweste wurde wohl nach der geglückten Ankunft am Strand zurückgelassen, manches wurde erst von den Wellen angespült.

Tag 5: Lesbos – wo Menschenrechtsverletzungen trauriger Alltag sind
Unsere Kollegin Efi Latsoudi erzählt uns mehr dazu, wie die Situation auf Lesbos sich über die Jahre verändert hat. Efi arbeitet dort seit über 15 Jahren mit Geflüchteten, unter anderem im schon erwähnten Projekt PIKPA. Für ihren Einsatz dort wurde sie 2016 auch mit dem Nansen-Preis der Vereinten Nationen gewürdigt, aber selbst solche Auszeichnungen konnten die griechische Regierung nicht daran hindern, diesen Ort der Menschlichkeit zu schließen. Efi macht trotzdem unermüdlich weiter mit ihrer Arbeit.
»Wir sind sehr erschöpft von der Situation. Es ist eine sich immer wiederholende Situation von Menschenrechtsverletzungen, von Todesfällen. Aber ich glaube an das, was wir tun, ich glaube, dass es hundertprozentig notwendig ist. Und wir brauchen mehr Menschen, die sich anschließen, die handeln und gegen diese Art der Politik kämpfen.« (Efi Latsoudi, Nansen-Preisträgerin der UN)
Das gleiche gilt für Mohammadi, der uns anschließend von seinen Erlebnissen berichtet. Vom Oktober 2015, als das Krankenhaus alle verfügbaren Leute selbst aus dem Urlaub zusammenrief, um irgendwie die Kinder zu retten, die dort nach mehreren Schiffsunglücken hingebracht wurden – eines davon war Reswana. Von einem Schiffsunglück 2009, nach dem er selbst eine Depression bekam. Aber auch von einer Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Kind mit dem Boot noch in türkischen Gewässern kenterte. Sie konnte nicht schwimmen, alle mussten davon ausgehen, dass sie ertrunken war, während die anderen beiden sich an Wrackteile klammern konnten. 17 Stunden später rief das Krankenhaus bei Mohammadi an. Eine Frau wurde dort eingeliefert: Die Wellen hatten sie tatsächlich lebendig bis nach Griechenland gespült.

Wie vielen Menschen Mohammadi über die Jahre hinweg geholfen hat, kann er uns nicht sagen, es müssen Tausende gewesen sein. Aber er erzählt uns, dass direkt nach seiner eigenen Ankunft auf Lesbos ein Taxifahrer ihm und anderen Schutzsuchenden Essen und Getränke brachte. Dem Taxifahrer selbst war einst in Australien geholfen worden, das wollte er zurückgeben und bat die Geflüchteten, dies eines Tages ihrerseits zu tun. Dieses Versprechen hat Mohammadi definitiv erfüllt.
Anschließend folgt der für uns härteste Teil der Reise. 2015 war der örtliche Friedhof voll, es brauchte einen Platz für die Leichen der ertrunkenen Flüchtlinge. An einem abgelegenen Ort wurde der Flüchtlingsfriedhof »Kato Tritos« errichtet. Mittlerweile ist er leider etwas verwildert, die Behörden haben die Aufsicht einer Person übertragen, die nicht mit unseren Kolleg*innen zusammenarbeiten möchte. Die beginnende Verwahrlosung macht die Umgebung dort noch trauriger. Die meisten Gräber sind mit einfachen Holzstöcken markiert, viele davon unbeschriftet –namenlose Gräber für die Menschen, deren Geschichten unerzählt bleiben. Es gibt aber auch Steine oder Marmorplatten mit Namen der Verstorbenen. Hin und wieder stehen Bilder dort, wie das von einem Baby, das im Dezember 2022 beigesetzt wurde, nur zehn Monate alt. Eindrücke, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Auch Reswanas Familie liegt auf diesem Friedhof begraben. Wie vielen anderen hilft es ihr, dass sie jetzt wenigstens einen Ort hat, um Abschied zu nehmen, um zu trauern. Wir selbst halten es nicht lange auf dem Friedhof aus.
Auf dem Rückweg in die Stadt kommen uns zwei Vans der Polizei entgegen. Mit diesen Fahrzeugen werden immer wieder die illegalen Pushbacks durchgeführt. Denn mittlerweile werden Flüchtlinge nicht mehr »nur« an der Landgrenze zurückgeschoben oder mit ihren Booten abgedrängt. Auch wenn die Menschen bereits auf den Inseln angekommen sind, bringen die Behörden sie häufig wieder zurück aufs Meer und setzen sie dort aus. Kein Wunder, dass die offiziellen Ankunftszahlen zurückgehen.
Tag 6: Frankfurt – Die Ungleichheit vor Augen geführt
So schön der Austausch mit den Kolleg*innen war, so froh sind wir, nicht noch weitere Tage voller Zäune, Lagern und Bildern von Leichen vor uns zu haben. Es ist für uns kaum vorstellbar, wie man diese Arbeit über so viele Jahre hinweg machen kann, ohne den Glauben an die Menschheit zu verlieren. In Griechenland und speziell auf den Inseln werden die bedrückenden und unmittelbaren Folgen der europäischen Flüchtlingspolitik deutlich. In Deutschland verschließen wir davor nur allzugern unsere Augen, hier ist das schlicht nicht möglich.

Und bei der Rückkehr in Frankfurt wird uns die erlebte Ungleichheit und Ungerechtigkeit noch einmal vor Augen geführt: Obwohl Griechenland Mitglied des Schengen-Raums ist, erfolgt beim Aussteigen aus dem Flugzeug eine Kontrolle durch die Bundespolizei. Man sucht hier nach Flüchtlingen. Das Muster ist klar: Wir können problemlos passieren, aber alle Menschen, die unter Racial Profiling-Kriterien ins Raster passen, werden genauestens überprüft, eine Familie wird von der Bundespolizei mitgenommen.
(mk/jo)