News
»Unser primäres Ziel war es, Zugang zu Informationen zu gewährleisten«
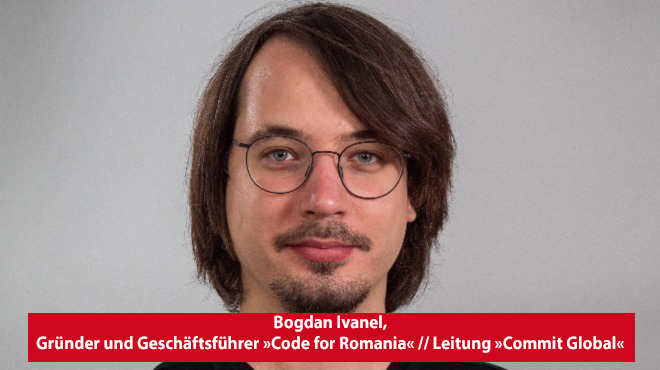
Asylsuchende in Rumänien berichten von brutalen Push-Backs, gleichzeitig erhalten ukrainische Geflüchtete mit einer eigens geschaffenen Webplattform Hilfe. Die treibende Kraft hinter dem Online Tool ist die NGO Code for Romania. Gründer und Geschäftsführer Bogdan Ivanel, der auch die NGO Commit Global leitet, berichtet im Interview von der Arbeit.
Kannst du bitte kurz darauf eingehen, wann und warum Code for Romania gegründet wurde?
Code for Romania wurde vor sieben Jahren gegründet, zu einem Zeitpunkt, als die rumänische Zivilgesellschaft an einem Wendepunkt stand: Ende 2015 kamen bei einem Brand in einem Bukarester Konzertclub mehr als 60 Menschen ums Leben. Ich traf mich mit anderen Rumän*innen, die in den Niederlanden lebten, und wir stellten fest, dass in Rumänien digitale Technologie als Mittel für sozialen Wandel kaum zum Einsatz kommt. So entstand Code for Romania. Unser Ziel war es, andere NGOs mit digitalen Werkzeugen auszustatten, um bessere Arbeit leisten zu können. In Rumänien gibt es traditionell sehr gute IT-Ingenieur*innen und viele von ihnen hatten das Bedürfnis, sich ehrenamtlich zu engagieren. Im Jahr 2019 waren wir mit über 2.000 freiwilligen Helfer*innen bereits die zweitgrößte zivilgesellschaftliche Technologiegemeinschaft weltweit. Im März 2020 fanden wir uns im Zuge der Corona-Pandemie plötzlich in der Rolle wieder, nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch die rumänische Regierung zu unterstützen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es in Rumänien keine staatliche Institution gibt, die sich mit Digitalisierung beschäftigt. Daher waren wir es, die die digitale Infrastruktur zur Bewältigung der Corona-Krise aufgebaut haben und die von nahezu der gesamten Bevölkerung Rumäniens genutzt wurde. Und gerade als wir dachten, alles würde sich wieder ein Stück weit normalisieren, begann der Krieg in der Ukraine.
Wie habt ihr nach dem Angriff Russlands reagiert?
Bereits am ersten Tag des Krieges haben wir beschlossen, alle anderen Projekte, an denen wir gearbeitet haben, auf Eis zu legen. Wir haben uns umgehend mit der rumänischen Regierung, den UN-Organisationen und anderen Organisationen der rumänischen Zivilgesellschaft in Verbindung gesetzt. Innerhalb weniger Stunden gelang es uns, eine breite Koalition zu bilden und nach nur 48 Stunden ging die Informationsplattform »dopomoha.ro « online. »Dopomoha« ist das ukrainische Wort für Hilfe. Die Webseite stellt Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Rumänisch zur Verfügung. In anderen Ländern gibt es viele verschiedene Plattformen: Die UN-Organisationen verbreiten Informationen, die NGOs vor Ort und die Behörden machen das ebenfalls. Oft sind die zugänglichen Informationen widersprüchlich und die Art der Formulierung unterscheidet sich stark. Das bringt Risiken für die Geflüchteten mit sich, weil sie nicht wissen, wem sie vertrauen können. Im Gegensatz dazu ist es uns in Rumänien gelungen, alle relevanten Akteure zusammenzubringen, um mit einer Stimme zu sprechen. Diese Stimme ist »dopomoha.ro«. Der Rest unserer Aktivitäten wurde darum herum aufgebaut. Die Geflüchteten müssen sich nur an »dopomoha.ro« erinnern, dort erhalten sie Zugang zu wichtigen Informationen, aber auch zu Wohnraum, psychologischer Unterstützung und Gesundheitsversorgung.
Wie ist es euch gelungen, die verschiedenen Akteur*innen von der Notwendigkeit einer gemeinsamen digitalen Plattform zu überzeugen?
Ein sehr wichtiger Punkt war die Geschwindigkeit, mit der wir gehandelt haben. Innerhalb weniger Stunden hatten wir Kontakt zu den relevanten Akteur*innen aufgenommen und mit der Arbeit an der Plattform begonnen. Hätten wir zu viel Zeit verstreichen lassen, hätten vermutlich viele ihre eigenen Plattformen eingerichtet. Erfahrungsgemäß ist es schwieriger, jemanden wieder von etwas abzubringen, was er bereits tut. Der zweite wichtige Punkt war, dass wir die Fähigkeiten und Ressourcen hatten, um schnell handeln zu können. Es ist uns gelungen, die Informationen, die wir von unterschiedlichen Seiten bekommen haben, in »dopomoha.ro« zu integrieren und dabei Formulierungen zu verwenden, die Geflüchtete auch verstehen können. Vor allem mit den Behörden gab es deswegen viele Gespräche, weil sie zu einer sehr technokratischen Sprache neigen.
Kannst du bitte noch etwas detaillierter auf die verschiedenen Bereiche eingehen, die ihr mit eurer Arbeit unterstützt?
Unser primäres Ziel war es, Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass weder die Behörden, noch die UN-Organisationen oder die lokalen NGOs über eine effiziente digitale Infrastruktur verfügten. Deswegen haben wir zunächst eine Plattform zur Verwaltung von Unterbringungsplätzen entwickelt. Wenn Geflüchtete über »dopomoha.ro« Unterbringungsbedarf anmelden, wird diese Anfrage zunächst an die zuständige Behörde weitergeleitet, welche sich dann in Kooperation mit anderen Organisationen darum kümmert. So ist es möglich, den Geflüchteten eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Mit einer weiteren von uns entwickelten Plattform ist es möglich, alle anderen Arten von Hilfe zu koordinieren: Von Transport über Medikamente bis hin zu Kleidung und Lebensmitteln. Das war nicht nur notwendig, damit die Organisationen vor Ort effizienter arbeiten können und keine Excel-Tabellen oder ähnliches verwenden müssen, sondern auch, um die Sicherheit der Geflüchteten zu gewährleisten. Wenn Sie beispielsweise eine Frau mit zwei kleinen Kindern sind und sich plötzlich in einem Land wiederfinden, in dem Sie noch nie zuvor waren und dessen Sprache sie nicht verstehen, kann es leicht passieren, dass sie jemand mitnimmt, der Ihnen eine Mitfahrgelegenheit oder eine Unterkunft anbietet. Selbst wenn 99 % der Menschen einfach nur helfen wollen, muss dennoch unbedingt vermieden werden, dass Schlimmes passiert. Ein weiteres Projekt von uns zielt auf chronisch kranke Menschen ab, die die Grenze nicht ohne weiteres überqueren können. Wir sprechen hier von Krankheiten wie Krebs, HIV oder Multiple Sklerose. Diese Menschen brauchen dringend kontinuierlichen Zugang zu medizinischer Versorgung, weshalb wir digitale Werkzeuge für das Fallmanagement entwickelt haben: Ukrainer*innen können mittlerweile bereits in ihrem Heimatort über »dopomoha.ro« auf medizinische Dienste zugreifen und können sicher sein, dass jemand auf sie wartet und sie ärztlich versorgt werden. Außerdem haben wir ein digitales Gesundheitszentrum für Frauen eingerichtet, die schwanger sind, Babys haben oder einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchten. Mehr als 40 rumänische und moldauische Organisationen kooperieren in diesem Bereich, um Frauen, die Hilfe, die sie benötigen, zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus arbeiten wir momentan an einer Plattform für psychologische Hilfe, da wir festgestellt haben, dass es einen immensen Bedarf an ukrainischsprachigen Psycholog*innen gibt.
Wie funktioniert die Unterbringungsplattform in der Praxis und wie viele Menschen wurden über sie bereits vermittelt?
In verschiedenen Ländern sind zahlreiche Unterbringungsinitiativen entstanden. Es geht jedoch nicht nur darum, die Nachfrage mit Menschen zusammenzubringen, die Wohnraum anbieten wollen, sondern auch darum, zu gewährleisten, dass der angebotene Wohnraum sicher und geeignet ist. Über die Wohnungsplattform werden verschiedene Unterbringungsformen verwaltet: Staatliche Einrichtungen und Einrichtungen, die von NGOs betrieben werden. Hinzu kommen Zimmer, die von Unternehmen wie Hotels angeboten werden, und Wohnungen von Privatpersonen. Letztere werden vor der Vermittlung von den Behörden kontrolliert. Bei der Zuteilung von Wohnraum werden zunächst staatliche Einrichtungen berücksichtigt und dann Wohnraum, der von Unternehmen und NGOs verwaltet wird. Dieser ist leichter zu verwalten und zu kontrollieren als der von Privatpersonen zur Verfügung gestellte Wohnraum. Allein in den letzten beiden Wochen sind über die Unterbringungsplattform mehr als 9.000 Anfragen eingegangen, wobei eine Anfrage mehrere Personen betreffen kann. Auch die Dauer der gewünschten Unterbringung unterscheidet sich: Manche Menschen wollen nur ein paar Tage in Rumänien bleiben und dann weiterreisen, andere wollen länger bleiben.
Wie arbeitet Code for Romania intern?
Ein wesentlicher Punkt, der Code for Romania von vielen anderen zivilgesellschaftlichen IT-Initiativen unterscheidet, ist, dass wir sehr viel recherchieren, bevor wir die erste Zeile Code schreiben. Wir hatten das Glück, dass wir vor einigen Jahren zur Vorbereitung auf ein Erdbeben in Bukarest recherchiert hatten, was in den nächsten Jahren passieren könnte. Dabei wurde uns klar, dass es einen Bedarf an digitalen Werkzeugen zur Zuteilung von Wohnraum gibt, also entwarfen wir erste Lösungen. Aber wir hatten nicht die finanziellen Mittel und die Energie, um dieses Projekt weiterzuführen. Als der Krieg ausbrach, war die Arbeit bereits zur Hälfte erledigt: Wir wussten, was wir programmieren müssen, und das hat uns eine Menge Zeit gespart. Zudem waren wir in der komfortablen Situation, unsere große Gemeinschaft von ehrenamtlichen Helfer*innen einbinden zu können. Im ersten Monat haben 500 Menschen Tag und Nacht gearbeitet. Die Plattformen für die Zuteilung von Wohnraum und die zur Koordination sonstiger Hilfen wurden von ihnen entwickelt. Als der Druck dann nach einiger Zeit etwas nachließ und wir Gelder akquirieren konnten, haben wir bezahlte Mitarbeiter*innen eingestellt. Freiwillige können dieses Arbeitspensum nicht dauerhaft bewältigen.
»In Rumänien können ukrainische Geflüchtete auf eine zeitgemäße digitale Infrastruktur zurückgreifen«
Was ist eure Vision für die Zukunft?
In Rumänien können ukrainische Geflüchtete auf eine zeitgemäße digitale Infrastruktur zurückgreifen. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Deswegen sehen wir uns in der Verantwortung, unsere Infrastruktur auch anderswo zur Verfügung zu stellen. Wir führen bereits Gespräche mit Behörden und NGOs in anderen Ländern. Begonnen haben wir mit Moldau, weil hier die Sprachbarriere am geringsten ist. Aber wir haben auch erste Kontakte nach Bulgarien, Finnland und Deutschland geknüpft, um herauszufinden, wie wir möglicherweise helfen können und welche unserer Lösungen dort anwendbar sind. Mittelfristig wollen wir sicherstellen, dass unsere digitale Infrastruktur erhalten bleibt und weltweit dort eingesetzt werden kann, wo sie gebraucht wird. Zu diesem Zweck haben wir eine neue Organisation namens »Commit Global« gegründet.
Das Interview führte Marc Speer, der im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von PRO ASYL und bordermonitoring.eu über die Situation von ukrainischen Geflüchteten in den Nachbarstaaten der Ukraine berichtet.