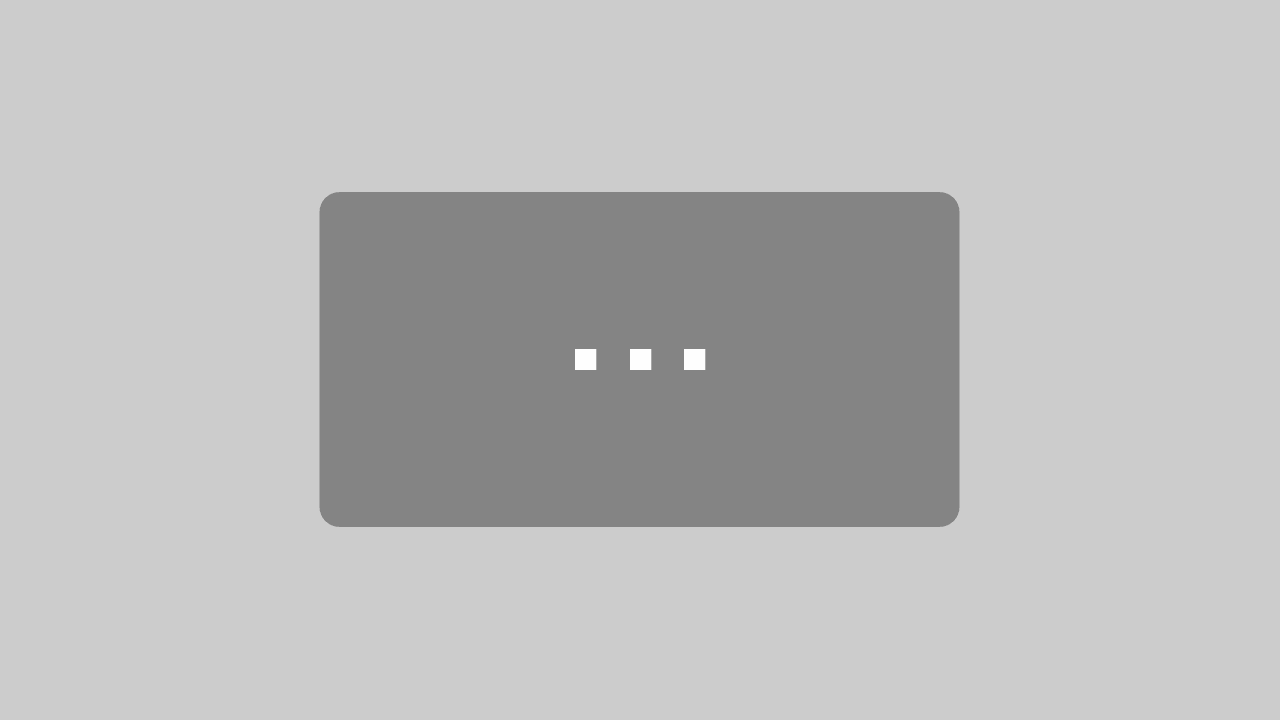News
Solidarisch mit Flüchtlingen sein: Diesen Wert dürfen wir nicht aufgeben

»Vor zehn Jahren habe ich gesehen, wie die Bewohner*innen von Lesbos Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Heute wird in der öffentlichen Debatte behauptet, dies sei ein Fehler, ein Verbrechen gewesen«, schreibt Efi Latsoudi von Refugee Support Aegean. Sie erinnert sich zurück an den Sommer der Solidarität in Griechenland.
Ich bin 2001 nach Lesbos gezogen. Das war fast 80 Jahre, nachdem meine neunjährige Großmutter als Flüchtling aus Ayvalık auf dieselbe Insel gekommen war. Sie blieb dort zwei Jahre, bevor sie nach Piräus zog. Meine Großmutter gehörte zu den fast 1,5 Millionen Griech*innen, die in den 1920er Jahren aus Kleinasien fliehen mussten.
Bis 2001 war die Geschichte von Lesbos als Zufluchtsort fast in Vergessenheit geraten, und doch diente die Insel weiterhin als Zwischenstation für Menschen, die das östliche Mittelmeer überquerten, um in Europa Schutz zu suchen.
Im Jahr 2015 stand Lesbos erneut im Mittelpunkt eines nächsten Kapitels der Fluchtgeschichte. Kriege und Instabilität zwangen Millionen Menschen zur Flucht über das Meer. Fast die Hälfte derjenigen, die versuchten, Griechenland zu erreichen, kamen auf der Insel an.
Die Solidarität blühte auf
Die Bewohner*innen von Lesbos standen im Mittelpunkt einer humanitären Antwort, die weltweite Anerkennung fand. Es war eine Zeit, in der die Welt begann, über die Solidarität der Griech*innen gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen zu sprechen, obwohl das Land mitten in einer Wirtschaftskrise steckte.
Wenn ich an die Solidarität denke, die in diesen Tagen aufblühte, sehe ich ausgestreckte Hände entlang der Küsten von Lesbos. Es gab unzählige bewegende Geschichten von Einheimischen, die halfen, wo sie konnten, und Lebensmittel, Kleidung und Decken aus ihren Häusern brachten, um die Neuankommenden zu versorgen.
Die Bewohner*innen von Lesbos standen im Mittelpunkt einer humanitären Antwort, die weltweite Anerkennung fand.
Als sich die Straßen der Insel mit neu Angekommenen füllten, die zu den Registrierungsstellen gingen, verging kein Tag, an dem die Eingesessenen nicht einer schwangeren Frau, einem Kind oder einer Person mit Behinderung, die wir auf dem Weg zur Arbeit trafen, anboten, sie ein Stück mitzunehmen. Die dankbaren Blicke, das Lächeln, die Tränen und die endlosen Dankesbekundungen sind unvergesslich. Solidarität wurde zu einem Ehrenzeichen, und begeisternde Geschichten von Menschlichkeit und Hoffnung füllten die Medien.
Die Insel war verwandelt – ihre Straßen und Plätze füllten sich mit lokaler Bevölkerung und neu Angekommenen, die sich vermischten, eine Szene menschlicher Verbundenheit und gelebter Menschlichkeit.
16 erschöpfte Flüchtlinge im Wohnzimmer
An einem Tag klopfte eine Flüchtlingsfamilie an meine Tür und bat darum, sich die Hände waschen und etwas Wasser trinken zu dürfen. Sie waren seit Tagen unterwegs, hatten im Park geschlafen und auf ein Boot gewartet, um ihre Reise fortzusetzen. Ich öffnete meine Tür und 16 Menschen kamen herein – darunter acht kleine Kinder, ein Neugeborenes und ein querschnittsgelähmtes Mädchen. Mein kleines Wohnzimmer füllte sich; sie saßen auf Stühlen, dem Sofa, sogar auf dem Boden. Bevor ich ihnen Wasser bringen konnte, waren die Kinder bereits eingeschlafen, und die Erwachsenen, erschöpft, schlossen ihre Augen. Ihre Körper gaben der Last ihrer Müdigkeit nach.
Leise verließ ich den Raum und ließ sie ruhen. Am nächsten Morgen verabschiedeten sie sich und gingen an Bord der Fähre. Sie hinterließen eine Dankeskarte mit einer handgezeichneten Blume und 16 Namen.
Wenn ich an diese Tage zurückdenke, kommen mir viele Bilder in den Sinn: Menschen im Regen, Menschen in der Kälte, Menschen, die feiern, und andere, die um ihre Toten trauern. In diesem Sommer nahmen wir an einer Beerdigung nach der anderen teil. Wir gedachten derjenigen, die die gefährliche Seereise nicht überlebt hatten.
»Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem fremden Land zu sterben und ohne seine Liebsten begraben zu werden.«
Ein palästinensischer Freiwilliger sagte mir einmal: »Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem fremden Land zu sterben und ohne seine Liebsten begraben zu werden.« Wenn ihre Liebsten nicht da waren, waren wir da. Die Fremden waren für uns keine Fremden mehr, sie gehörten zu uns.
Im Oktober 2015 sank vor der Westküste von Lesbos ein Holzboot mit mehr als 300 Menschen an Bord. Als sich die Tragödie entfaltete, strahlten Akte der Menschlichkeit. Freiwillige aus anderen Ländern und Bewohner*innen der Insel, darunter auch Fischer, eilten zur Hilfe, zogen Menschen aus dem Meer und boten ihnen jeden nur möglichen Trost. In den folgenden Tagen wurden Leichen an Land gespült, und die Leichenhalle füllte sich.
Doch selbst als die Küsten der Insel zu einem Symbol der Solidarität wurden, begannen die sich wandelnden Strömungen der europäische Grenzpolitik bereits, die Realität für die Ankommenden neu zu gestalten.
Eine Frau von der Insel hielt ein totes Kind in ihren Armen. Es war ein kleines Mädchen, das tot am Strand vor ihrem Haus gefunden worden war. Sie wickelte es in ein Laken und hielt es wie ihr eigenes Kind – so wie jeder ein Kind halten würde.
Doch selbst als die Küsten der Insel zu einem Symbol der Solidarität wurden, begannen die sich wandelnden Strömungen der europäische Grenzpolitik bereits, die Realität für die Ankommenden neu zu gestalten.
Der EU Türkei Deal: Ein Frontalangriff auf den internationalen Flüchtlingsschutz
Einige Monate später änderte sich die europäische Grenzpolitik, Asylsuchende saßen fortan auf der Insel fest. Der Deal zwischen der EU und der Türkei zwang Asylsuchende dazu, auf der Insel zu bleiben auf der sie gelandet waren, während die Behörden prüften, ob sie in die Türkei, die als »sicheres Drittland« galt, zurückgeschickt werden konnten.
Der Deal zeigte, dass die Europäische Union bereit war, von den Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit abzuweichen, und er zeigte, dass Grenzverfahren und das Konzept des sicheren Drittstaats eine Gefahr für das Leben von Flüchtlingen und Migrant*innen darstellten. Es war ein Frontalangriff auf den internationalen Flüchtlings- und Menschenrechtsschutz, zudem instrumentalisierte der Deal das Leid der Menschen.
Leider haben sich diese Maßnahmen seitdem noch verschärft und wurden schließlich auf staatlicher Ebene institutionalisiert, insbesondere mit den im Mai 2024 verabschiedeten Änderungen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Die Reform markiert eine radikale Verschlechterung der EU-Vorschriften und institutionalisiert die diskriminierende Behandlung von Flüchtlingen sowie Ausnahmeregelungen, die Aufhebung von Grundrechten und Rechtsschutz und, die Verhängung von verlängerter und massenhafter Inhaftierung.
Fremdenfeindliche Politik führte zu fremdenfeindlichen Schlagzeilen
Auf Lesbos sah ich unterdessen, wie das Lächeln der Menschen verblasste, zusammen mit ihren Hoffnungen, die in und rund um das Lager Moria zerbrochen wurden. Moria, das Lager war 2013 als kleine Einrichtung entstanden und war nie dafür gedacht, die Tausenden von Menschen aufzunehmen, die später dort untergebracht wurden. Die psychische Gesundheit der Flüchtlinge und Migranten verschlechterte sich rapide, begleitet von einem deutlichen Anstieg der Zahl der Selbstmordversuche.
Während die Zahl der Menschen stieg, setzen sich die entsetzlichen Bedingungen, die Versorgungsengpässe, die Überbelegung und die extreme Unsicherheit zu einer verzweifelten tagtäglichen Realität zusammen, die zum Nährboden von Frustration, Wut und manchmal auch Gewalt wurde. Das war der Moment, als die Behörden und Medien begannen, ihr Narrativ zu ändern. Flüchtlinge und Migrant*innen wurden nicht mehr als verzweifelte Seelen dargestellt, die in das Land kamen und in Lagern litten. Sie wurden nun als Bedrohung für das Land beschrieben.
Solidarität wurde Teil des Problems. Sie wurde zu einer öffentlichen Beleidigung, zu einer Verhöhnung. Obwohl Nichtregierungsorganisationen und Freiwillige aufgefordert wurden, Lebensmittel und Unterstützungsmaßnahmen bereitzustellen und die endlosen Lücken in der humanitären Hilfe zu füllen, wurden sie gleichzeitig von Behörden der Korruption und Kriminalität bezichtigt. Gesunder Menschenverstand, Menschlichkeit und Solidarität – das Grundgerüst des sozialen Zusammenhalts – wurden zur Zielscheibe. Die Gesellschaft driftete auseinander.
Fremdenfeindliche Politik führte zu fremdenfeindlichen Schlagzeilen, Retter*innen wurden zu Verfolgten, und zunehmend rassistische Stimmen dominierten den öffentlichen Diskurs und bedrohten die Erinnerung an diese Insel, auf der einst Menschlichkeit herrschte.
Die Ereignisse von 2015 wurden als eine massive Katastrophe verheerenden Ausmaßes dargestellt, die sich nie wiederholen dürfe. Das Wunder der Solidarität, das weltweite Aufmerksamkeit, Ressourcen und Lösungen für eine immense humanitäre Krise hervorgebracht hatte, wurde diffamiert. Abschreckungsmaßnahmen, Pushbacks, gefängnisgleiche Flüchtlingslager und die Kriminalisierung von Solidarität und Zivilgesellschaft wurden nun als einzige Lösungen präsentiert. Die Polarisierung vertiefte sich und befeuerte Gewalt gegen Asylsuchende, Geflüchtete und solidarische Menschen.
Im Lager Moria
Das Lager Moria – ein Ort, der nur als Friedhof der Menschenrechte bezeichnet werden kann – wurde zu einer tickenden Zeitbombe für die Bewohner*innen der Insel. Zu seinem Höhepunkt hatte es sich in eine riesige Siedlung aus Zelten und Baracken, ohne hinreichenden Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen verwandelt.
Menschlichkeit gibt Sicherheit
An einem Nachmittag im Oktober 2016 wartete ich im Lager Moria auf unseren Dolmetscher, damit wir einer Familie den Termin für ihr Asylinterview mitteilen konnten. Dunkle Wolken zogen auf. Um mich herum trugen Menschen ihre Habseligkeiten zusammen, Kinder spielten im Dreck mit allem, was sie finden konnten, und junge Männer schleppten Pappe und Plastik herbei, um sich vor dem einsetzenden Regen zu schützen.
Als ich dort inmitten all dessen stand, beobachtete ich einen Kampf ums Überleben unter Bedingungen, die keiner von uns auch nur eine Stunde lang ertragen würde. Doch immer wieder kam jemand auf mich zu und bot mir Wasser, Tee oder ein Stück Pappe zum Sitzen an, damit ich »nicht stehen musste«. Durch ihr Lächeln fühlte ich mich in Sicherheit und umsorgt, ihre Menschlichkeit war trotz allem unerschütterlich.
Durch ihr Lächeln fühlte ich mich in Sicherheit und umsorgt, ihre Menschlichkeit war trotz allem unerschütterlich.
Als die Wolken dichter wurden, half ich einer Frau, ihr Zelt mit Steinen zu sichern. Ich bückte mich und sah, dass das Zelt voller kleiner Kinder war. Wie konnten so viele Kinder in ein so kleines Zelt passen? Ich bewunderte ihren Mut und ihre Entschlossenheit, sie zu beschützen. Ich lächelte sie an, und dort, mitten im Nirgendwo, vor einem Zelt, das jeden Moment vom Regen weggespült werden konnte, nahm sie meine Hand und lud mich ein, mit ihnen zu essen.
Wie konnten solche Extreme in einem einzigen Moment zusammenkommen? Das Elend, die Unmenschlichkeit der Bedingungen und die Gastfreundschaft, das Miteinander und die Stärke, die sie selbst unter den härtesten Umständen ausstrahlten. Wie konnte ein einziger Moment sowohl Not als auch Würde, sowohl Verzweiflung als auch Großzügigkeit einfangen? Die Steine, mit denen sie ihre Zelte befestigten, sicherten sie auch unsere untereinander geteilte Menschlichkeit?
Eine Begegnung im Supermarkt
Zurück in der Stadt, wo die Stimmen gegen Flüchtlinge und Migrant*innen immer lauter wurden, ging ich zum Supermarkt. Als ich in der Schlange stand, drehte sich die Frau vor mir um und beklagte sich: »Wir werden von Ausländern überrannt. Sie sind überall. Was soll nur aus ihnen werden?« Sie deutete auf eine junge Schwarze Frau an der Kasse.
Die anderen Kund*innen nickten grimmig. Ich überlegte, wie ich reagieren sollte, während ich beobachtete, wie die junge Frau ihre wenigen Einkäufe auf den Tresen legte. Dann stellte sie fest, dass sie nicht genug Geld hatte, und begann, die wenigen Äpfel in ihren Korb zurückzulegen.
Ich sah die Frau vor mir an, die die Szene beobachtete. Aus Angst, sie würde anfangen zu schreien, hielt ich den Atem an. Stattdessen nahm sie mit einer entschlossenen Bewegung die Äpfel. »Ich bezahle das, mein Mädchen«, sagte sie zu der jungen Frau, die sie verwirrt ansah. »Nimm sie, lass sie nicht liegen.«
Die junge Frau bedankte sich, umarmte sie und ging. Und ich hörte, wie die ältere Frau vor sich hinmurmelte: »Was können sie tun? Wer weiß, was sie durchgemacht haben? Aber was können wir schon tun?«
Dieser Meinungsbeitrag von Efi Latsoudi (Refugee Support Aegean) wurde im englischen Original am 3. Mai 2025 bei Al Jazeera veröffentlicht und von PRO ASYL frei übersetzt.
Efi Latsoudi arbeitet für die PRO ASYL-Schwesterorganisation Refugee Support Aegean auf Lesbos. Die Menschenrechtsaktivistin wurde 2016 mit dem Nansen-Flüchtlingspreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet.