News
Geflüchtete Frauen schützen – Aufnahmebedingungen verbessern!
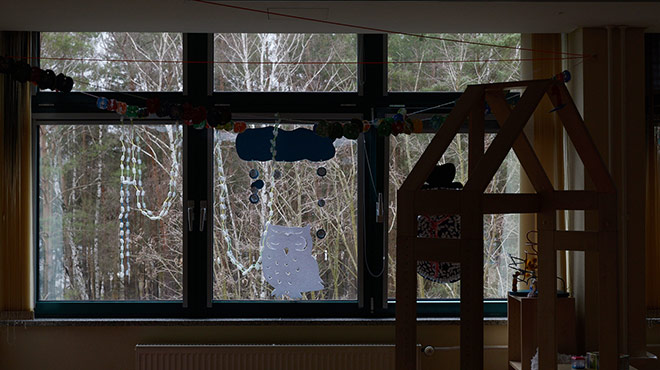
Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25.11. macht PRO ASYL darauf aufmerksam, dass geflüchtete Frauen und Mädchen in Deutschland in der Praxis des Aufenthalts- und Asylrechts nicht ausreichend vor Gewalt geschützt werden. Teile des Aufnahmesystems befördern sogar Gewalterfahrungen.
Rund 50.000 Frauen und Mädchen haben im bisherigen Jahr 2021 in Deutschland Asyl beantragt, mehr als die Hälfte von ihnen sind noch minderjährig. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Türkei, Nigeria, Iran, Somalia, Eritrea und anderen Ländern. Dort herrschen zumeist seit Jahren Krieg und Vertreibung. Physische, sexualisierte wie auch psychische und strukturelle Gewalt gegen Frauen ist alltäglich.
Genitalbeschneidung ist eine in manchen Regionen weit verbreitete Menschenrechtsverletzung. Frauen werden zwangsverheiratet oder versklavt, teilweise schon als Kinder. Vergewaltigungen bleiben faktisch straffrei oder werden den Frauen selbst angelastet. Im Krieg werden systematische Vergewaltigungen von Frauen als Waffe eingesetzt.
Verfolgte Frauen haben Anspruch auf Aufnahme, gesundheitliche Versorgung und den Schutz vor weiterer Gewalt. Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich die Bundesrepublik 2018 völkerrechtlich verbindlich dazu verpflichtet, Frauen unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status vor allen Formen von Gewalt zu schützen, einen Beitrag zur Beseitigung ihrer Diskriminierung zu leisten und ihre Gleichstellung und ihre Rechte zu fördern.
Im deutschen Aufnahmesystem existieren aber vielfach Bedingungen, unter denen der Schutz von geflüchteten Frauen und Mädchen vor Gewalt und die Entwicklung ihrer Rechte von vornherein beschränkt sind, und die sogar ihrerseits gewaltvoll sind oder Gewalt befördern. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung von PRO ASYL und Flüchtlingsräten zur Umsetzung der Istanbul Konvention.
Für einen konsequenten Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt müssen auf Bundes- wie auf Länderebene einige Weichen neu gestellt werden:
Frauen, die Gewalt erlitten haben, zählen zu den besonders schutzbedürftigen Geflüchteten. Die Bundesländer sollen solche vulnerablen Menschen zu Beginn ihres Aufenthalts identifizieren und unterstützen. Das passiert in der heterogenen Praxis der Länder jedoch unsystematisch und unzureichend. Dies kann auch negative Folgen für die Asylprüfung haben. Das Bund muss bei den Bundesländern auf einheitliche qualifizierte Identifizierungsverfahren hinwirken. Besondere Maßnahmen im Rahmen geschlechtersensibler Asylverfahren (wie etwa die Anhörung durch eine qualifizierte Sonderbeauftragte oder mehr Vorbereitungszeit vor der Anhörung) müssen als durchsetzbare Rechte der Betroffenen ausgestaltet sein.
Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen wird im Asylverfahren kaum als Asylgrund erkannt: 2020 erhielten von annähernd 60.000 antragstellenden Frauen gerade einmal 1.300, 2,2 Prozent der Frauen, internationalen Schutz aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung. In den vorigen Jahren und im bisherigen Jahr 2021 sind die Quoten kaum besser.
Frauen, die nicht aus anderen, etwa familiären Gründen bleiben dürfen, drohen die Ablehnung ihres Asylantrags und die Abschiebung aufgrund einer nicht ausreichend sensibilisierten Asylprüfung. Das Bundesamt hat keine aussagekräftigen Daten zum gesamten Themenkomplex. Betroffene brauchen eine individuelle, unabhängige Asylverfahrensberatung durch qualifizierte nichtstaatliche Organisationen. Das Bundesamt muss die Asylverfahren gendersensibler gestalten, die Möglichkeit frauenspezifischer Gewalt in jedem Fall selbst aktiv abklären und seine Entscheidungspraxis verbessern.
Für Frauen und Mädchen erweisen sich Sammelunterkünfte als Einrichtungen, in denen sie nicht nur erlittene Gewalt schlechter be- und verarbeiten können, sondern unter Umständen auch zusätzlicher Gewalt ausgesetzt sind. Mangelnde Privat- und Ruhesphäre, fehlende Rückzugsräume, die Abgelegenheit der Unterkünfte und soziale Isolation vergrößern die Gefahr von Übergriffen durch männliche Bewohner, (Security-)Personal oder Fremde von außen. Trotz vieler Initiativen und Modellprojekte in den letzten Jahren sind Gewaltschutzkonzepte noch immer in vielen Einrichtungen nicht vorhanden oder werden nicht wirksam umgesetzt. Vergleichbare, verbindliche und effektive Gewaltschutzstandards sind notwendig. Die Zeit in der Erstaufnahme muss auf maximal vier Wochen begrenzt werden. Grundsätzlich muss die Wohnungsunterbringung von Geflüchteten Vorrang haben vor der Unterbringung in Sammelunterkünften.
Frauen, die Gewalt erlitten haben und traumatisiert sind, brauchen psychosoziale Unterstützung und eine gute Gesundheitsversorgung. In der Praxis gibt es vielfältige Probleme: Die Kosten für eine Sprachmittlung werden nicht übernommen, eine fachärztliche Untersuchung oder eine Psychotherapie wird abgelehnt oder zunächst eine teure ärztliche Stellungnahme angefordert. Hintergrund ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), das Geflüchtete mindestens in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts schlechter stellt als andere Bedürftige. Eine Datenanalyse der Universität Kassel belegt, dass vor allem in der Erstaufnahme eine Krankenbehandlung auf Sparflamme praktiziert wird. Asylsuchende müssen normale Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung werden, das Asylbewerberleistungsgesetz ist abzuschaffen. Die Kapazitäten für die Behandlung von Gewaltopfern und traumatisierten Geflüchteten im medizinischen und psychosozialen Bereich – inklusive Dolmetschleistungen – müssen ausgebaut und finanziert werden.
Hinderlich für einen effektiven Schutz und Hilfe bei Gewalterfahrungen wirken Wohnort-Zuweisungsregelungen, Wohnsitzauflagen und Einschränkungen der Freizügigkeit (Residenzpflicht). Sie verhindern oder erschweren es Frauen und Mädchen, sich in ein für sie hilfreiches Umfeld zu begeben – zum Beispiel bei Verwandten zu wohnen, in die Nähe einer unterstützenden Community umzuziehen oder auch nur das weiter entfernt liegende Psychosoziale Zentrum aufzusuchen. Zwar gibt es Härtefallregelungen, etwa wenn Frauen vor häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus fliehen. In der Praxis führt eine heterogene und teils willkürliche Anwendungspraxis trotzdem vielerorts dazu, dass ein Umzug nicht kurzfristig stattfinden kann. Frauen und Mädchen sollten ihren Wohnort grundsätzlich selbst bestimmen dürfen. Im Rahmen des existierenden Zuweisungssystems müssen ihre Wünsche berücksichtigt werden, sie müssen Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Wohnort erhalten. Sämtliche Freizügigkeitsbeschränkungen sind aufzuheben.
Der gesetzlich stark eingeschränkte und schleppende Familiennachzug geht in spezifischer Weise zu Lasten von Frauen und Kindern: Im Herkunfts- oder in Flüchtlingslagern eines Drittlands harren sie als Angehörige in Deutschland geschützter Flüchtlinge häufig unter sehr schwierigen sozialen, politischen und gesundheitlichen Bedingungen aus. Im schlimmsten Fall kann ein verschleppter oder gänzlich verweigerter Familiennachzug für die im Ausland wartenden Frauen und Mädchen bedeuten, dass ihnen Gewalt angetan wird. Bei üblichen Wartezeiten von zwei bis vier Jahren werden so etwa heranwachsende Mädchen im Herkunftsland noch der Genitalverstümmelung (FGM) unterzogen, was bei zügigerem behördlichen Handeln hätte vermieden werden können. Um Frauen und Mädchen davon zu bewahren, ist den Angehörigen von anerkannten und subsidiär geschützten Flüchtlingen der Familiennachzug in einem deutlich beschleunigten Antragsverfahren zu ermöglichen.
Etliche Frauen aus den Hauptfluchtländern haben – auch aufgrund bürokratischer Hürden – keinen eigenen Asylantrag gestellt, sondern besitzen über ihren Mann ein eheabhängiges Aufenthaltsrecht. Bei einer Trennung droht der Verlust des Aufenthaltsrechts. Zwar gibt es im Fall von häuslicher Gewalt eine Härtefallregelung, diese hat sich aber als unzureichend erwiesen. Damit Frauen sich selbst vor Gewalt in der Familie schützen können, brauchen sie aufenthaltsrechtliche Unabhängigkeit und Sicherheit. Gesetzlich muss sichergestellt werden, dass eine Frau, die vor häuslicher Gewalt flüchtet, nicht deshalb ihr Aufenthaltsrecht verliert, sondern ein eigenständiges, verlängerbares Aufenthaltsrecht erhält.
Auch Bildung und finanzielle Unabhängigkeit ist Gewaltprävention. Die Nachteile, die geflüchtete Frauen gegenüber Männern haben – ein durchschnittlich niedrigerer Bildungsstand, weniger Erwerbstätigkeit, geringere Deutschkenntnisse – sind nicht nur patriarchalen Verhältnissen im Herkunftsland geschuldet, sondern auch zu wenig gendersensiblen Aufnahmebedingungen in Deutschland. Notwendig sind spezifische, gut erreichbare und bedürfnisorientierte Deutsch- und Integrationskurse inklusive Kinderbetreuung sowie gezielte Aus- und Weiterbildungsangebote für alle geflüchteten Frauen – ohne diskriminierende Unterscheidung nach Herkunftsstaat oder Aufenthaltsstatus.
Auf ihrem Fluchtweg und an Europas Grenzen sind Frauen und Mädchen massiv von Gewalt betroffen – hier wird der menschenrechtliche Schutzauftrag in sein Gegenteil verkehrt. Ob Griechenland, Kroatien, Polen oder im Mittelmeer: Durch die systematische Entrechtung, Isolierung und Inhaftierung von Schutzsuchenden und die fortdauernden völkerrechtswidrigen Pushbacks werden Menschen, die schon vieles erlitten haben, weiterer Gewalt ausgesetzt. Das Ziel der Istanbul-Konvention ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und ein Europa frei von Gewalt gegen Frauen zu schaffen. Die Bundesregierung ist hier in der Mitverantwortung. Sie muss sich für den ungehinderten Zugang zu einem fairen, regulären Asylverfahren in der EU einsetzen. Verfolgte Frauen und Mädchen und anderen vulnerablen Personen müssen besondere Unterstützung und Schutz erhalten.
Fallbeispiel: Joy P.*
Joy P. wird schon als kleines Mädchen Gewalt angetan: Von ihrem Stiefvater wird sie schwer sexuell missbraucht und körperlich misshandelt. Als die inzwischen jugendliche Nigerianerin es nicht mehr aushält, haut sie von Zuhause ab. Sie findet einige Zeit Aufnahme als Hausmädchen. Dann verspricht ihre Arbeitgeberin ihr, dass sie in Europa in die Schule gehen darf und organisiert die Ausreise. Joy glaubt ihr – tatsächlich aber ist sie in die Fänge von Menschenhändler*innen geraten. In der EU angekommen, wird sie monatelang zur Prostitution gezwungen, bevor ihr die Flucht gelingt. Sie versucht, sich in einem anderen Teil des EU-Landes ein neues Leben aufzubauen. Dort wird sie aber von einer Person aus dem kriminellen Netzwerk gefunden und bedroht. In großer Angst flieht sie erneut und kommt nach Deutschland.
Es hat die Unterstützung durch eine Anwältin, zwei Beratungsstellen, eine Ärztin und die finanzielle Unterstützung durch einen Hilfsfonds gebraucht, um das Bundesamt davon zu überzeugen, dass Joy schutzbedürftig ist.
Das Bundesamt lehnt den Joys Asylantrag als unzulässig ab und erklärt den EU-Ersteinreisestaat für zuständig. Es kann »keine außergewöhnlichen humanitären Gründe« erkennen, das Asylverfahren in Deutschland durchzuführen, denn es glaubt der jungen Frau ihre Geschichte nicht – obwohl eine Sonderbeauftragte für Menschenhandel einbezogen wird und obwohl Joy ein fachärztliches Gutachten vorlegt.
Dann erfährt Joy von Unterstützer:innen, dass gegen das international agierende Netzwerk polizeiliche Ermittlungen laufen. Sie macht bei der deutschen Polizei eine Aussage. Daraufhin gibt das Bundesamt schließlich nach. Nach einer weiteren Anhörung mit einer weiteren Sonderbeauftragten für Menschenhandel wird Joy subsidiärer Schutz zugesprochen. Joy müsse, so begründet das BAMF diese Entscheidung, bei einer Rückkehr nach Nigeria Vergeltungsmaßnahmen der Menschenhändler*innen befürchten.
Zweieinhalb Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland kann Joy endlich in Sicherheit leben und beginnen, ihre Geschichte zu verarbeiten. Es hat die Unterstützung durch eine Anwältin, zwei Beratungsstellen, eine Ärztin und die finanzielle Unterstützung durch einen Hilfsfonds gebraucht, um das Bundesamt davon zu überzeugen, dass Joy schutzbedürftig ist. Eine geschlechtsspezifische Verfolgung sieht das BAMF in Joys Fall aber immer noch nicht.
*Name zum Schutz der Betroffenen anonymisiert
(ak)